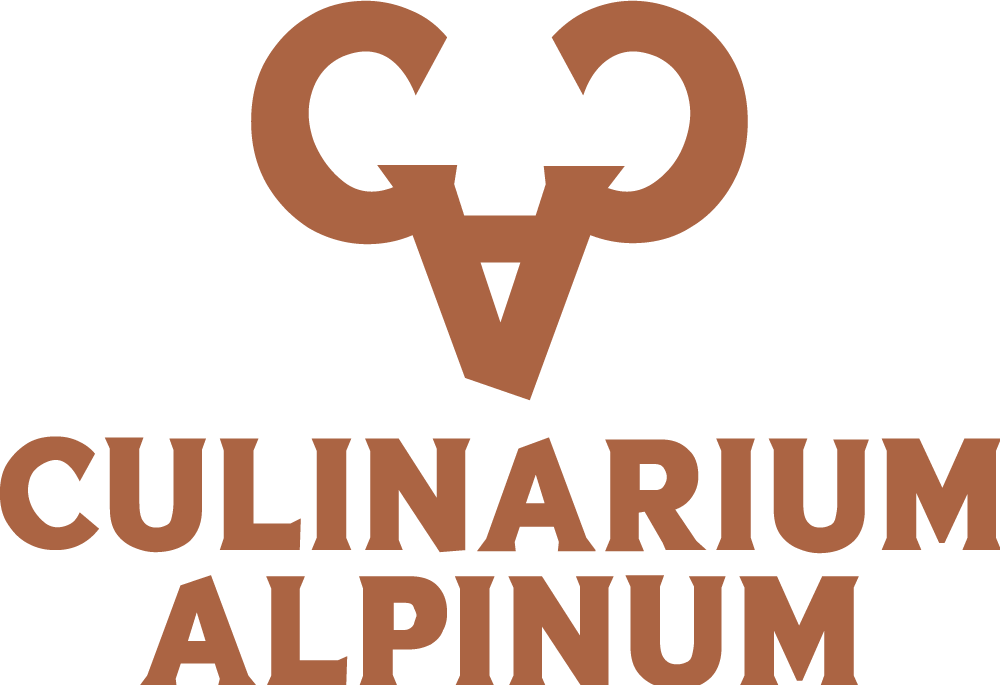Willkommen im CULINARIUM ALPINUM - Informationen zum Mediaguide

Willkommen im CULINARIUM ALPINUM - Informationen zum Mediaguide
Willkommen im Culinarium Alpinum!
Das Culinarium Alpinum – hier kommen Geschichte, Genuss und die Vielfalt der Regionalkulinarik im Alpenraum zusammen. Andres Lietha, Geschäftsführer der Stiftung, heisst sie herzlich willkommen!
Das Gebäude hat eine bewegte Vergangenheit. Es wurde im Jahr 1584 als Kapuzinerkloster erbaut und diente fast 400 Jahre lang als Ort des Gebets, der Bildung und des Dienstes an der Gemeinschaft. Seit 2020 erstrahlt das Kloster in neuem Glanz – als Zentrum für Regionalkulinarik im Alpenraum. Hier wird die Verbindung zwischen Tradition, Innovation und Nachhaltigkeit gelebt. Der Autor Dominik Flammer hat im Buch über das Kulinarische Erbe der Alpen das Thema für ein breites Publikum zugänglich gemacht und ist Initiator des Culinarium Alpinum.
Während Ihres Rundgangs durch die Essbare Landschaft haben Sie die Möglichkeit, in die Vielfalt der Pflanzenwelt einzutauchen und Überlegungen zum aktuellen Zeitgeschehen mitzuverfolgen. Die Essbare Landschaft ist übrigens als Naschgarten konzipiert. Greifen Sie also zu, wenn sie süsse Früchte und reife Beeren entdecken!
Dieser Mediaguide ist entstanden, um unseren Besucherinnen einen einfachen Zugang zum CULINARIUM ALPINUM zu ermöglichen. Bitte beachten Sie, dass bei privaten oder öffentlichen Anlässen nicht alle Stationen zugänglich sein können. Wir bitten Sie, auf dem Rundgang immer Rücksicht auf andere Gäste zu nehmen und den Betrieb nicht zu stören.
Interessierten Personen bieten wir sehr gerne auch persönliche Führungen an. Dabei vertiefen wir sämtliche Elemente dieses Mediaguides, ebenfalls sind Kombinationen mit anderen Angeboten wie Seminare, Degustationen und Kochkursen möglich.
Brauchen Sie Hilfe auf dem Rundgang? Sprechen sie unser Personal an oder melden sie sich am Empfang.
Haben Sie Rückmeldungen zu diesem Mediaguide? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme via keda@culinarium-alpinum.ch.
Gehen Sie nun vor das Klostergebäude, zur Einfahrt und vor die Türe zum Klosterladen. Dort startet der Rundgang durch die Essbare Landschaft.

Die Essbare Landschaft
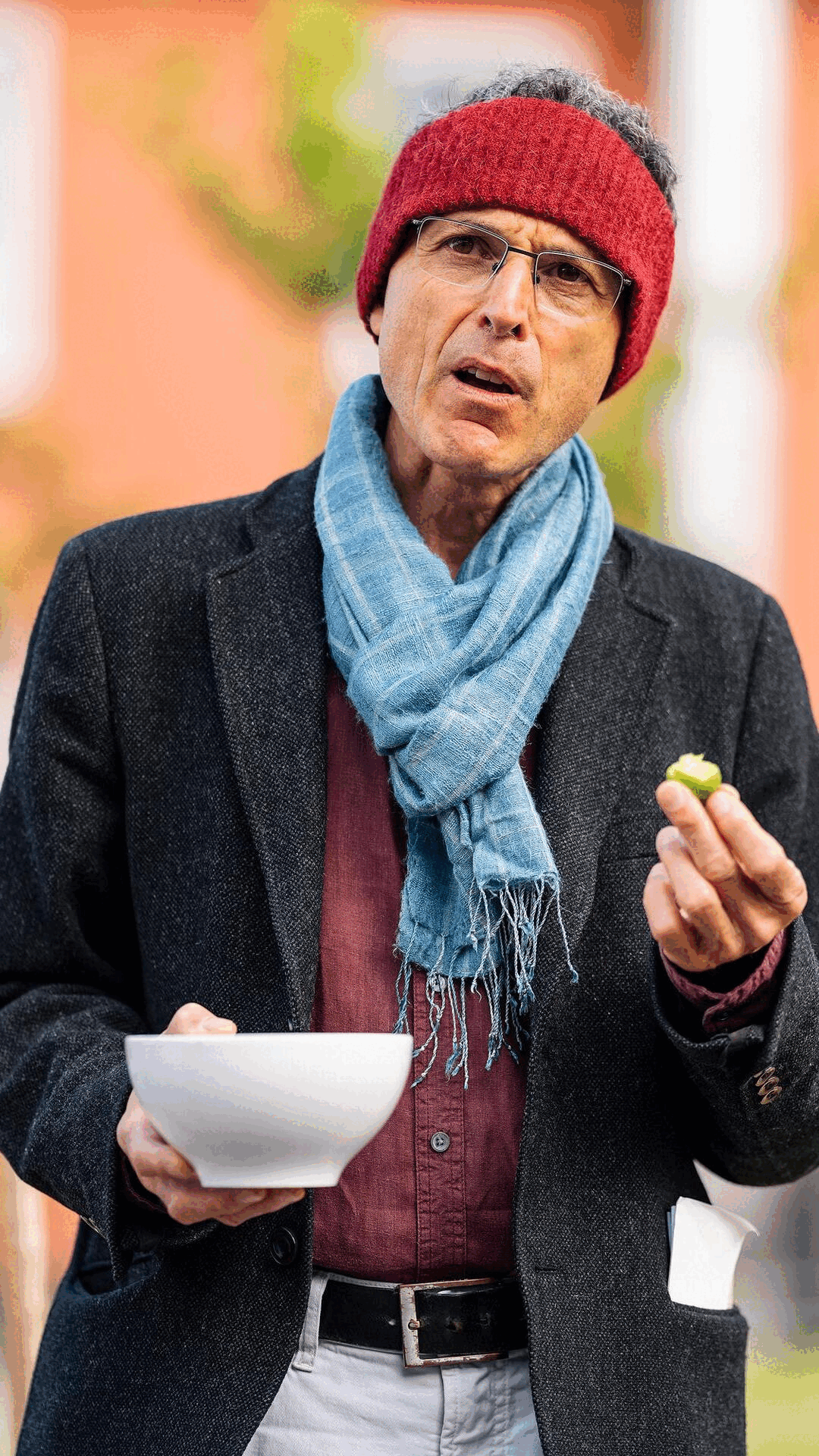
Die Essbare Landschaft
Die Essbare Landschaft
Sigi Tatschl, gebürtiger Zürcher mit österreichischen Wurzeln, lebt heute in Kirchberg am Wagram – einem Ort, der sich durch sein Engagement längst in einen Obstgarten verwandelt hat. Schon als Kind verband er mit Beeren ein tiefes Gefühl von Glück und Zeitlosigkeit. Auslöser war eine Szene unter einem alten Birnenbaum am Rand einer Weide: Dort wuchsen wilde Walderdbeeren, süß und duftend. Diese frühen Geschmackserlebnisse prägten ihn nachhaltig.
Seine Leidenschaft für Früchte entwickelte sich mit den Jahren weiter – getrieben von einer neugierigen, sammelnden Natur. Tatschl wollte wissen, was hinter den Sorten steckt, sammelte Raritäten wie Maulbeeren, chinesische Datteln oder Silberbüffelbeeren. Der eigene Garten wurde bald zu klein. Aus dieser Fülle heraus entstand eine Vision: Obst soll nicht nur im privaten Raum gedeihen, sondern überall – in Parks, Schulgärten, auf Grünstreifen oder vor Kindergärten. Für ihn ist keine Fläche zu klein, um nicht bepflanzt zu werden.
Heute versteht Sigi Tatschl seine Arbeit als Beitrag zur Gestaltung von „Gärten der Zukunft“. Als ihn Dominik Flammer ins CULINARIUM ALPINUM nach Stans einlud, war für ihn sofort klar: Hier entsteht ein weiteres Beerenparadies. Beeren, so glaubt er, können mehr als nur schmecken. Sie verbinden Generationen, laden zum gemeinsamen Ernten und Genießen ein – und schaffen so ein Gefühl von Gemeinschaft. Eine Qualität, die es mehr denn je für eine lebenswerte Zukunft braucht.
Starten Sie den Rundgang am Eingang der Klostermauern. Entlang der Mauer finden Sie rund um den Parkplatz die Obsthecke.
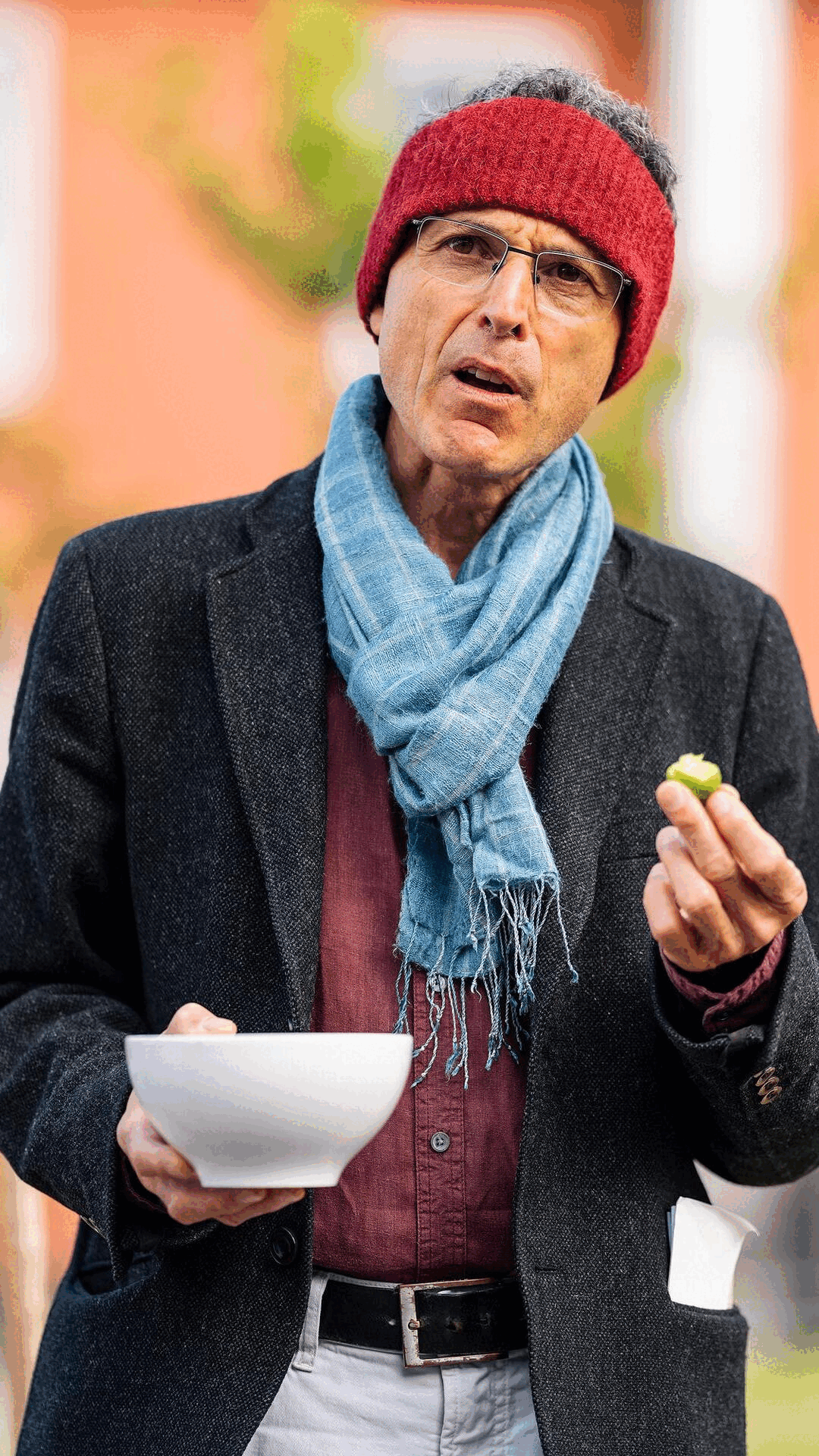
Die Obsthecke
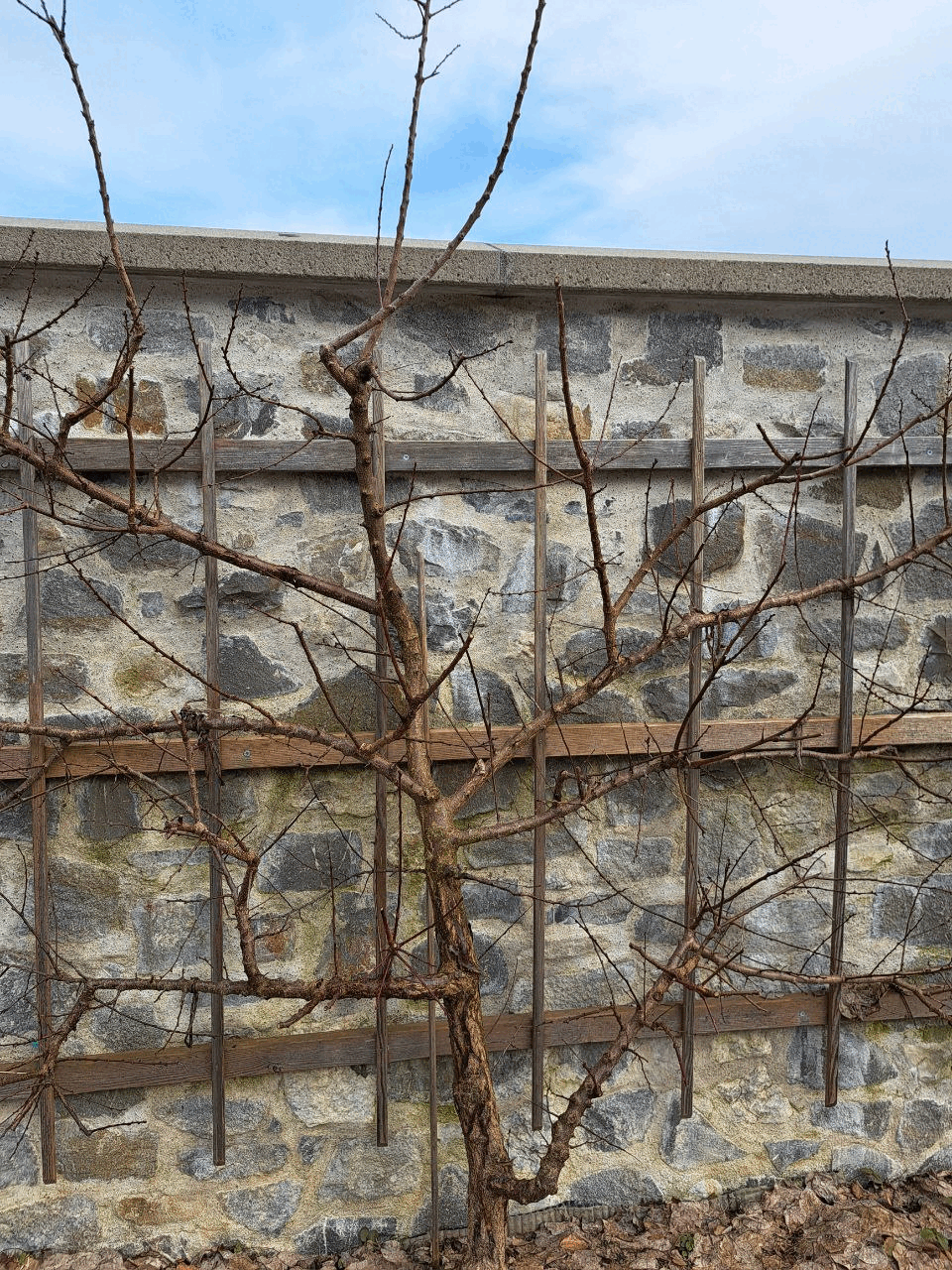
Die Obsthecke
Die Obsthecke
In diesem Teil der Essbaren Landschaft des CULINARIUM ALPINUM entsteht eine Landschaftsobsthecke mit vielfältigen Gehölzen, die sich in den kommenden Jahren zu einem artenreichen Biotop entwickeln soll. Zwischen Weg und Klostermauer wachsen bereits Bäume und Sträucher – ein lebendiger Gegenentwurf zu eintönigen Grauflächen. Weiter unten, zwischen Parkplatz und Fahrweg, hat das Team eine Vielfaltsobsthecke angelegt: Johannisbeeren, Gelbornsträucher mit essbaren Nüssen, Strauchweichseln und der rotfleischige persische Apfel ‘Bakran’ mit seiner auffälligen Blüte machen den Streifen zum fruchtbaren Lern- und Erlebnisraum. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf unsere Spalierbäume entlang der Klostermauern. Der Spalierschnitt ist optisch auffällig, eignet sich für Bäume entlang von Mauern, und ist dafür geeignet, dem Baum eine lange Nutzungszeit zu geben.
Gerade solche Grünflächen entlang von Straßen, Gehwegen oder Parkplätzen gibt es zahlreich in Städten und Dörfern. Für Sigi Tatschl, den Initiator der Hecken, sind sie perfekte Standorte für naturnahe Obsthecken. Statt eintöniger Zierpflanzen können hier essbare und artenreiche Gehölze wachsen – entlang von Schulzäunen oder Kindergärten etwa, wo sie nicht nur Sichtschutz bieten, sondern auch soziale und ökologische Räume verbinden.
Ein besonders eindrückliches Beispiel ist die Obsthecke am Schulzaun: Kinder naschen in der Pause Beeren, Passant:innen greifen auf dem Weg zur Arbeit nach Pflaumen oder Minikiwis. Solche Begegnungen fördern Gemeinschaft und sensibilisieren für die Herkunft unserer Lebensmittel.
Das CULINARIUM ALPINUM unterstützt Schulen und Gemeinden bei der Umsetzung solcher Projekte – von der Pflanzenauswahl bis zur Planung. Wer selbst eine Vielfaltsobsthecke pflanzen möchte, findet hier Wissen, Beratung und die passenden Sorten für eine essbare, lebendige Zukunft.
Gehen Sie an der linken, äusseren Seite des Parkplatzes die Treppe hoch und folgen Sie dem Weg bis zur Rondelle. Links und Rechts sehen Sie das Streuobst.
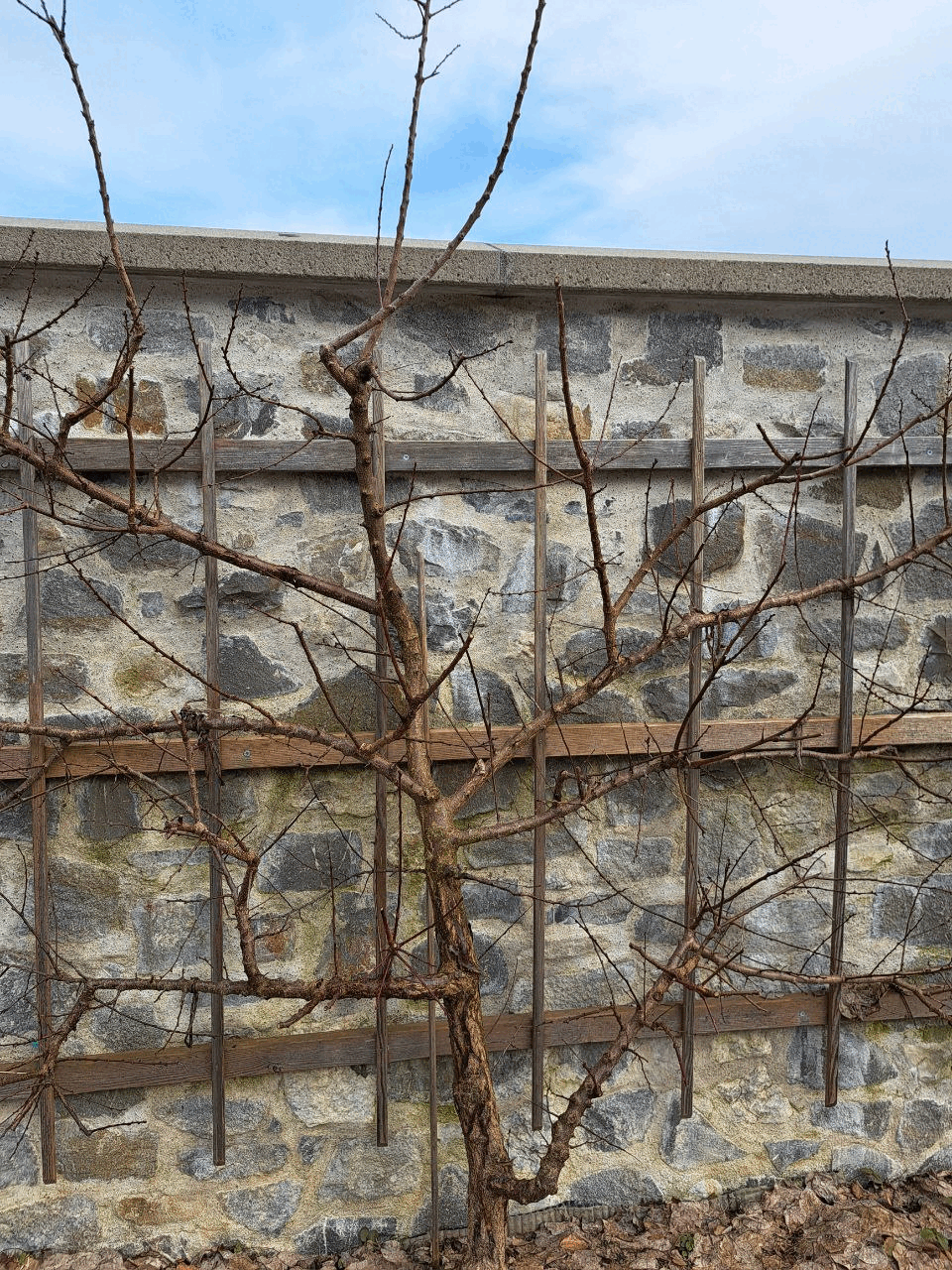
Das Streuobst

Das Streuobst
Das Streuobst
Mitten im Garten des CULINARIUM ALPINUM breitet sich eine junge Streuobstwiese aus. Streuobstwiesen entstanden ursprünglich Ende des 19. Jahrhunderts aus der doppelten Nutzung landwirtschaftlicher Flächen: Das Heu diente dem Vieh, das Obst der Selbstversorgung. Die Bäume wurden damals nicht in festen Reihen gepflanzt, sondern scheinbar „hingestreut“. Fiel ein Baum aus, wurde er einfach durch die gerade verfügbare Sorte ersetzt – so entstand eine bunte Vielfalt.
Traditionell prägen großkronige Hochstammbäume das Bild: mächtige Kirsch-, Apfel- oder Birnbäume neben schlankeren Zwetschken-, Mispel- oder Pflaumensorten, oft nahe von Höfen oder an schwer bewirtschaftbaren Stellen wie Bachrändern oder steilen Wiesen. Heute sind diese artenreichen Lebensräume selten geworden – ihre ökologische Bedeutung bleibt jedoch hoch.
Im CULINARIUM ALPINUM wurde die Idee neu gedacht: Kleinkronige Sorten wurden gewählt, die sich auch für städtische oder dörfliche Räume eignen. Die Vision dahinter: Die Schweiz als essbarer Landschaftsraum – voller lebendiger Obstgärten in Siedlungen, Parks und vor Gemeindezentren.
Ob Quitte oder Sauerkirsche, Pfirsich oder Pflaume: Obstbäume als Nahversorger im öffentlichen Raum bieten nicht nur köstliche Früchte, sondern auch Bildung, Begegnung und Resilienz. Ein Kakibaum etwa liefert nach einigen Jahren bis zu 50 kg Früchte – eine stille Reserve für Krisenzeiten. Doch oft genügt schon der kleine Genuss: ein frischer Apfel auf dem Heimweg, eine Pflaume beim Warten auf den Bus.
Das CULINARIUM ALPINUM zeigt, wie’s geht – und lädt Gemeinden, Schulen und engagierte Menschen ein, diese Idee aufzugreifen. Denn für jede „Safira“ oder „Kolodovidnaja“ – zwei schlanke Pflaumensorten – findet sich ein Plätzchen. Auch in deiner Stadt.
Verlassen Sie die Rondelle und gehen Sie den Weg entlang der Klostermauern bis zum Gartenzimmer. Unterwegs sehen Sie die Raritäten auf der linken oberen Seite.

Unsere Raritäten

Unsere Raritäten
Unsere Raritäten
Was macht eine Obstsorte eigentlich zur Rarität?? Oft ist es ganz einfach: Alles, was man noch nicht kennt, wirkt selten. Und im Fall von Obstsorten betrifft das einen Großteil der natürlichen Vielfalt. Im Laden begegnet man höchstens einer Handvoll Apfel- oder Birnensorten. Auch in vielen Baumschulen bleibt die Auswahl überschaubar. So entsteht bei Kindern und Jugendlichen ein verzerrtes Bild davon, wie bunt und vielfältig Obst eigentlich sein kann – es sei denn, sie besuchen die Essbare Landschaft des CULINARIUM ALPINUM.
Hier begegnet man einer Welt voller seltener Sorten: etwa der chinesischen Dattel, die im Herbst verkostet werden kann. Sie sieht aus wie eine Dattel, ist aber nicht mit ihr verwandt – genauso wie Kaki oder Susine, eine japanische Pflaumenart. Diese sogenannten „Neuen Exoten“ stehen traditionellen Arten wie Apfel und Birne gegenüber, die zwar schon lange aus Asien eingeführt wurden, aber im aktuellen Klima zunehmend an ihre Grenzen stoßen.
Die chinesische Dattel etwa trotzt Trockenheit, mag magere Böden, meidet Spätfrost und bleibt dabei aromatisch. Solche robusten Sorten sind Hoffnungsträger in Zeiten des Klimawandels – und eine Inspiration für die Zukunft heimischer Gärten.
Auch in der Schweiz gibt es überraschende Entdeckungen – wie die Zwergmehlbeere, eine echte alpine Exotin. Wer sie findet, hilft mit bei der Schatzsuche nach vergessenen Früchten. Was also ist deine Obstrarität?? Welche Sorte sollte erhalten bleiben oder neu entdeckt werden? Der Austausch mit neugierigen Gärtnerinnen, Sammlern und Entdeckerinnen ist ausdrücklich erwünscht.
Betreten Sie das Gartenzimmer, schauen Sie sich um und nehmen Sie sich gerne Zeit, um zu Geniessen. Am hinteren Ende befindet sich das Insektenhotel, wo Sie unsere kleinsten Helferlein bei der Arbeit beobachten können. Gehen Sie anschliessend rechts vom Insektenhotel die Treppe hinunter ins Schattenreich.

Pflanzen im Schattenreich

Pflanzen im Schattenreich
Pflanzen im Schattenreich
Nun führt uns der Weg in einen schattigen Bereich. Hier ist es kühler und stiller als die sonnige Wiese draußen. Der Ort wirkt beinahe wie ein Waldzimmer. Friedlich, geschützt und ideal zum Innehalten. Zwischen den Bäumen ragt eine Portugiesische Feige ins Licht, zu Füßen wächst die zarte Waldengelwurz.
Hier bietet sich die Gelegenheit, den Gedanken vom Beginn des Rundgangs nochmals aufzugreifen: Was kann jede und jeder zu einer guten Zukunft beitragen – und was haben Beeren damit zu tun? Natürlich retten Beeren nicht allein die Welt. Aber sie sind ein Symbol der Hoffnung, ein Versprechen von Fülle und Freude. Sie regen an, neu zu denken.
In diesem Moment der Ruhe stellt sich eine ungewöhnliche Frage: Wie würde unsere Umwelt die aktuellen Veränderungen erleben, wenn sie sprechen könnte? Wie geht es den Pflanzen – den Beerensträuchern, den Apfelbäumen?
Vielleicht würden sie sagen: „Ich brauche Sonne, aber nicht zu viel – sonst verbrenne ich. Ich brauche Wasser, das knapp wird. Und ohne Hummeln, Käfer, Schmetterlinge trage ich keine Früchte mehr.“ Ein eindringliches Bild. Wer zuhört, erkennt: Pflanzen brauchen unsere Fürsorge.
Die Antwort auf diese stumme Bitte könnte lauten: Sorgt für lebendige Vielfalt. Setzt Sträucher, Kräuter, Gräser in gute Erde, pflanzt große Bäume dazwischen, schafft Räume, in denen es brummt und flattert. Dann gedeihen auch wir Menschen mit.
Essbare Landschaften – bunt, vielfältig und lebendig – sind ein Zukunftsversprechen für Städte und Dörfer. Wer sie pflegt, investiert in eine lebenswerte Welt.
Kehren Sie anschliessend ins Gartenzimmer zurück, laufen bis ans vordere Ende des Gartenzimmers, biegen dort rechts ab und laufen Sie die Treppe eine Ebene nach unten. Folgen Sie dem Weg bis zum Kräuterbeet – dem neuesten Bereich in der Essbaren Landschaft.

Kräuterbeet und Blütenbeet

Kräuterbeet und Blütenbeet
Kräuterbeet und Blütenbeet
Das Kräuterbeet ist die jüngste Erweiterung der Essbaren Landschaft und wurde im Frühjahr 2025 angelegt. In den sorgfältig bepflanzten Beeten wachsen vielfältige Küchenkräuter sowie ausgewählte essbare Alpenpflanzen. Sie laden zum Riechen, Probieren und Entdecken ein. Hier treffen heimische Aromen auf alpine Würze.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Trockensteinmauer, die gemeinsam mit einem Fachmann errichtet wurde. Diese uralte Bauweise, im Alpenraum tief verwurzelt, kommt ohne Mörtel oder Beton aus. Die Steine wurden in grossen Blöcken aus einem nahen Steinbruch in Obwalden hergeschafft und hier vor Ort gespalten. Anschliessend wurde Stein für Stein kunstvoll präpariert und aufgeschichtet, sodass eine stabile, atmende Struktur entsteht. Die Mauer dient nicht nur der Abstützung, sondern schafft auch geschützte Nischen und Wärmeinseln – ideale Bedingungen für wärmeliebende Kräuter wie Thymian, Ysop oder Bergbohnenkraut. Gleichzeitig entsteht ein artenreicher Lebensraum für Eidechsen, Wildbienen und viele weitere kleine Gartenbewohner. Ein Ort, der zeigt, wie traditionelle Techniken und moderne Vielfalt zu einem lebendigen Ganzen werden.
Laufen sie dann die zwei Treppen hinunter auf den vorderen Teil des Parkplatzes. Hier finden Sie die Blütenbeete. Schliessen Sie dann den Rundgang «NaTour» im Restaurant bei einem Kaffee ab oder decken Sie sich im Klosterladen mit Leckereien aus dem Alpenraum ein.
Tipp: Falls Sie sich für einen Rundgang durch das Haus interessieren, fragen Sie im Restaurant oder an der Rezeption nach der Wegbeschreibung für den «KulTour» Rundgang.
Bis zum nächsten Mal!